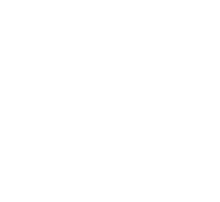Heimatland Lippe 10/2013
 Denkmal oder Kunstwerk? Gästeführerin Cornelia Müller-Hisje hinterfragte bei ihrer Führung am diesjährigen Tag des offenen Denkmals an den Externsteinen gängige Begriffe
Denkmal oder Kunstwerk? Gästeführerin Cornelia Müller-Hisje hinterfragte bei ihrer Führung am diesjährigen Tag des offenen Denkmals an den Externsteinen gängige Begriffe
Landesverband Lippe: Themen
Jenseits des Guten
und Schönen: unbequeme Denkmale?
Rückblick auf den
Tag des offenen Denkmals am 8. September
Beim Thema des diesjährigen Tages des offenen Denkmals drängte sich mir zunächst die Frage auf: Wie interpretiert man den Begriff Denkmal und sind demnach diese beiden Objekte ein solches?
Ich habe festgestellt, dass ein Denkmal gewöhnlich mit einer vom Erschaffenden (oder seinem Auftraggeber) bestimmten Absicht erbaut wird. Das Objekt steht nicht nur um seiner selbst willen dort,
sondern soll etwas, für den
Betrachter deutlich Erkennbares, zum Ausdruck bringen. z.B. eine Verehrung, einen Sieg, eine Tat.
Im Gegensatz zum Denkmal ist ein Kunstwerk, wenn es gut ist, nicht vorbestimmt, sondern vielseitig interpretierbar und somit unbequem, sogar über die Zeiten hinweg.
Folgerichtig gibt es kein unbequemes Denkmal, sondern höchstens eines, dessen Aussage wir nicht mehr verstehen, das also nicht mehr in die Zeit des Betrachters passt.
Wenn wir diese Interpretation des Denkmalbegriffs wählen, so steht uns natürlich sofort das Hermannsdenkmal vor Augen. Die dort verkörperte Figur des Arminius ist den meisten Betrachtern vage
bekannt: ein Germane, der römische
Legionen vernichtend geschlagen hat. Doch seine Motivation und die Bedeutung seiner Tat verschwinden dann, wie die römischen Truppen, in den sumpfigen germanischen Wäldern.
Wieso mehr als 1800 Jahre später ein Mann aus Ansbach (Bayern) glaubte, sein gesamtes Vermögen und seine Lebenskraft investieren zu müssen, um diesen Barbaren zum Nationalhelden zu stilisieren und ihm ein Denkmal zu endgültig nebulös.
Mit der Bedeutung des Ortes dieser Schlacht 9 n. Chr. Ergeht es dem Betrachter nicht besser. Er kann Goethe zitieren, der bereits 1801 bei einem Besuch in Bad Pyrmont schrieb, dass er sich
einfangen ließ von der Landschaft und ihrer
Geschichte. ,,... man mag sich wehren und wenden, wie man will, man mag noch so viel Abneigung beweisen vor solchen aus dem Ungewissen ins Ungewissere verleitenden Bemühungen, man findet sich wie in
einem magischen Kreise befangen, man identificirt das Vergangene mit der Gegenwart ... und fühlt sich zuletzt in dem behaglichsten Zustande, weil man für einen Augenblick wähnt, man habe sich das
Unfaßlichste zur unmittelbaren Anschauung gebracht. "1)
Der Versuch, das Hermannsdenkmal über seine Inschriften zu verstehen, gelingt heute nur noch dem Besucher, der relativ geschichtssicher aus dem Schulunterricht entlassen wurde. Und selbst dieser
wird feststellen, dass es schwierig ist, die Beweggründe des Erbauers Ernst von Bandel und der ihn unterstützenden Bevölkerung in die heutige Zeit zu transportieren und einem Betrachter zu
vermitteln. Ohne einen Blick in das Leben des Erbauers und auf die ihn umgebenden politischen Entwicklungen zu werfen, wird der interessierte Gast nur unverständig den Kopf schütteln über die im Fuße
des Denkmals eingravierten Worte. Und selbst beim Erfassen dieser Lebensumstände ist schon
sehr viel Einfühlungsvermögen notwendig, um die emotionale Situation der Menschen des 19. Jahrhunderts innerhalb des damals neu geschaffenen Kaiserreiches zu verstehen. Tun sich die heutigen
Deutschen nicht ohnehin sehr schwer
mit ihrer Nationalität und werden daher das Gefühlsgemenge der Menschen im 19. Jahrhundert nicht nachvollziehen können?
Bei all diesen Gedanken wird klar, dass es sich beim Hermann tatsächlich um ein Denkmal handelt. Es erinnert an die Befindlichkeit der erst neu entstandenen deutschen Nation im 19. Jahrhundert.
Und je weiter wir uns von dieser Zeit
entfernen, wobei wir zwei Weltkriege, die diese deutsche Nation gewaltig umgewälzt haben, nicht vergessen dürfen, wird Hermann wieder das, was Martin Luther ursprünglich unter dem Begriff Denkmal
verstand, nämlich eine ,,Gedächtnisstütze". Nicht mehr, aber auch nicht weniger, so dass der Titel des Tages des offenen Denkmals 2013 eigentlich gar nicht auf den Hermann zutrifft: Er ist nicht
unbequem. Er hilft uns, uns an historische Begebenheiten zu erinnern, die in der Entwicklung der Deutschen und ihrer Nation von großer Bedeutung waren. Er ist der ,,große Spickzettel" der Nation.
Wenden wir uns dem zweiten Objekt zu, das an diesem Tag betrachtet wurde, so bietet sich hier eine ganz andere Situation. Ich erinnere mich nochsehr gut an den ersten Sonntag vor zwei Jahren, an
dem ich als Gästeführerin an den Externsteinen tätig wurde. Ich hatte meine Schulung durch den Landesverband Lippe erhalten, mich vorab natürlich schon mit den Steinen beschäftigt und meinte, bestens
vorbereitet zu sein. Mit viel Freude und Begeisterung gab ich
mein Wissen über die Steine und ganz besonders über das Kreuzabnahmerelief weiter.
Zum Ende der Führung wurde ich von zwei schon etwas älteren Männern sehr aggressiv verbal angegangen, weshalb ich nicht auf die Urreligionen eingegangen sei, die doch an den Externsteinen
repräsentiert würden. Ich wusste, dass ich die Grabungsfunde und die Großskulpturen erwähnt hatte und war völlig konsterniert. Ob ich die einschlägige Fachliteratur nicht gelesen hätte und warum die
Kirche immer noch so viel Angst vor den alten Religionen
habe, dass sie ihre Bedeutung immer noch unterdrücken müsse?
Meine Anmerkungen, dass es außer den Großskulpturen und dem Sonnenwendloch in der Kapelle keine archäologischen oder sonstige Funde gäbe, die einen Hinweis auf Urreligionen festigen würden,
machten einen
Eindruck auf meine Kritiker. Es war auch nicht die Kritik als solche, die mich zweifeln ließ, ob ich dies Führungen weiter betreuen sollte, es war eher die Rücksichtslosigkeit, mit der die Männer
ihre Ansichten vorbrachten und damit insbesondere die anderen Führungsteilnehmer verwirrt zurück ließen.
Diese Erfahrung zeigt mir, dass die Externsteine ein Objekt sind, das viele Meinungen und unterschiedlichen Glauben zulässt, das polarisiert und das daher aus meiner Sicht ein Denkmal ist, sondern Kunst. Gute Kunst sollte unbequem sein, damit uns die Auseinandersetzung mit ihr weiterbringt. Die Steine sind für mich ein Kunstwerk, das von der Natur seit Jahrmillionen und von den Menschen seit Jahrtausenden hervorgebracht wurde. Sei es, dass der Mensch die natürlichen Formen weiterentwickelte (der Rufer, der Hängende), sei es, dass er völlig Neues schuf (das Kreuzabnahmerelief). Die Steine sind dabei nur das Material, das geformt wird. Sie lassen jede Deutung zu und die Kunstwerke aus allen Epochen der Menschheit nebeneinander bestehen.
Es gibt keine Überlieferungen, weder mündlich, noch schriftlich, die die Skulpturen erläutern. Noch nicht einmal das Kreuzabnahmerelief aus dem 12. Jahrhundert ist irgendwo dokumentiert. Wir sind als Betrachter aufgefordert, uns mit den Steinen auseinander zu setzen und sie emotional auf uns wirken zu lassen. Jeder Besucher wird in den Steinen das sehen, was er darin zu sehen glaubt. Er darf seiner Fantasie freien Lauf lassen und feststellen, dass sich abhängig von Jahres- und Tageszeit und abhängig von seiner persönlichen Befindlichkeit, ein immer neues Bild der Steine bietet.
Was wir daraus lernen können, ist, tolerant zu sein gegenüber Interpretationen, die uns von anderen Menschen, von Betrachtern mit einem anderen Blickwinkel oder als Erkenntnisse aus einer anderen Zeit zugetragen werden. Wobei ich mich ausdrücklich von nationalsozialistischen Schwarmgeistern distanziere. Sie haben nirgends einen Platz.
Wir sollten uns angewöhnen, die Steine nicht im Sinne eines Denkmals, als vorbestimmte Gedächtnisstütze für ein historisches Ereignis zu sehen, sondern als wunderbares, unbequemes Kunstwerk. Und dass die Menschen die Begegnung mit diesem Kunstwerk suchen, beweisen jährlich 500.000 Besucher an den Steinen.
Resümieren wir: An diesem Tag des offenen Denkmals begegneten die Besucher am Hermann einem Denkmal, das nur dann unbequem sein wird, wenn der Betrachter zu bequem ist, sich mit seiner Entstehung
und der Motivation des
Erbauers auseinander zu setzen, Das Denkmal an sich ist nur nicht mehr zeitgemäß.
An den Externsteinen erwartete den Gast ein Kunstwerk, das in Jahrmillionen von Natur und Menschen geschaffen wurde und immer wieder durch seine Verschwiegenheit und Wandelbarkeit fasziniert. Das Werk ist unbequem, aber kein Denkmal, denn wir kennen nicht die Kultur und auch nicht die Intention der Künstler, die diese Werke schufen.
1) Goethe’s Werke, hrsg. im Auftr. d. Großherzogin Sophie von Sachsen. Tag- und Jahreshefte (1801) Abt. 1 Bd. 35, Weimar 1892, S. 104 gefunden in Heimatchronik des Kreises Lippe von Erich Kittel 2. Auflage 1978 S. 19
Cornelia Mülller-Hisje
Die Verfasserin ist
Autorin, Publizistin und
u.a. Gästeführerin
des Landesverbandes
Lippe am Hermannsdenkmal und
an den Externsteinen
PADERZEITUNG
|
Gut, schön und gar nicht so unbequem |
|
Dienstag, 03 September 2013 | Autor: Peggy Pfaff |
|
Landesverband Lippe bietet Sonderführungen am Tag des
offenen Denkmals,
|